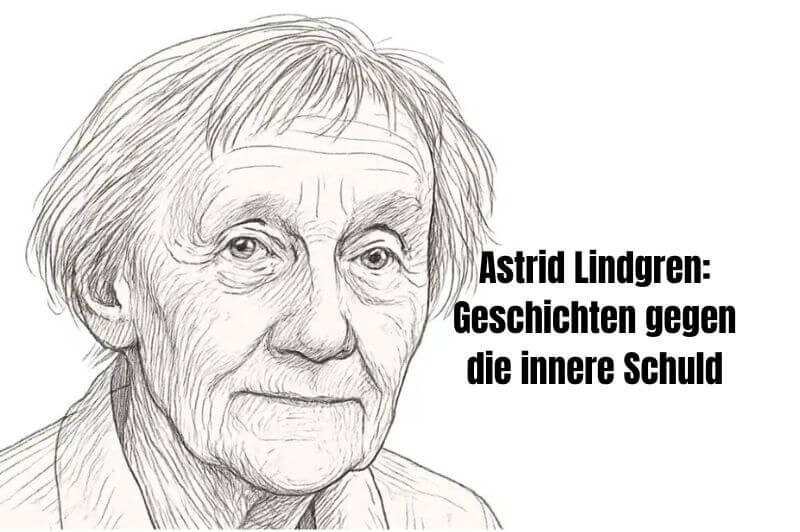
„Ich habe nie geschrieben, um zu erziehen. Ich wollte trösten.“
Manche Menschen schreiben Bücher.
Andere heilen durch sie.
Astrid Lindgren tat beides – ohne es je als Heldentat darzustellen.
Sie war weder eine politische Rebellin noch eine laute Feministin. Und doch war sie eine stille Revolutionärin – mit Worten, die ganze Generationen von Kindern begleitet und Erwachsene an das erinnert haben, was in ihnen längst verschüttet war: das verletzliche Kind, das sich nach Freiheit sehnt. Und nach bedingungsloser Liebe.
Doch ihre Geschichten entstanden nicht im luftleeren Raum.
Sie wuchsen aus einer Biografie, die viel mehr Risse hatte, als man von der warmherzigen „Mutter aller Kinderbücher“ vielleicht glauben möchte. Dieser Beitrag ist eine Spurensuche: nach dem Lebensthema hinter den Geschichten – und nach dem Trost, den auch wir darin finden können.
Eine Kindheit wie aus dem Bilderbuch – und ein erster großer Riss
Astrid Anna Emilia Ericsson kam am 14. November 1907 im südschwedischen Vimmerby zur Welt. Ihr Zuhause: der Hof „Näs“, idyllisch gelegen, voller Tiere, Spielmöglichkeiten und einer liebevollen Familie. Sie wuchs als zweitältestes von vier Kindern auf. Jahre später sagte sie:
„Unsere Eltern waren nie ungerecht. Es war eine wunderbare Kindheit. Ich kann nichts anderes sagen.“
Dieses frühe Glück prägte ihr Menschenbild – und ihr schriftstellerisches Ideal: eine Welt, in der Kinder sich sicher fühlen dürfen, wo sie ernst genommen werden, wo sie lachen und frei sein dürfen. Doch genau dieses Ideal wurde in ihrem eigenen Leben auf die Probe gestellt.
Mit 18 wurde Astrid schwanger. Der Vater war ihr Chef, der deutlich ältere Redakteur des „Vimmerby Tidning“. Eine Hochzeit? Kam für sie nicht in Frage. Astrid wollte nicht heiraten, nur weil sie „musste“. Eine selbstbestimmte Entscheidung – mutig für die Zeit, aber mit einem hohen Preis.
Sie reiste allein nach Kopenhagen, um ihren Sohn Lasse zur Welt zu bringen – anonym, fernab vom sozialen Druck ihrer Heimatstadt. Danach gab sie ihn in Pflege. Erst drei Jahre später, als sie eine Anstellung in Stockholm und ein stabiles Einkommen hatte, holte sie ihn zu sich. Die ersten drei Jahre im Leben ihres Sohnes war sie nicht bei ihm.
„Ich habe es getan, wie ich dachte, dass es richtig sei. Aber es hat mir das Herz gebrochen.“
Ein Kind zurückzulassen – selbst aus Not – hinterlässt Spuren. Beim Kind und bei der Mutter. Vielleicht war genau dieser Riss der Ursprung der späteren Figuren in ihren Büchern.
Figuren, die immer wieder das Gleiche erzählen: vom Verlassenwerden. Vom Wunsch, stark zu sein. Und der Sehnsucht, trotzdem gehalten zu werden.
Pippi Langstrumpf – Die Heldin mit der fehlenden Mutter
Pippi Langstrumpf wurde 1941 „erfunden“, auf Wunsch von Astrids Tochter Karin. Sie lag krank im Bett und wünschte sich eine Geschichte mit einer starken Hauptfigur. Das Ergebnis: ein rothaariges Mädchen, das allein in der Villa Kunterbunt lebt, ein Pferd hebt, Polizisten verspottet und in einer Welt lebt, die ihr nichts vorschreibt.
Pippi ist Freiheit pur. Aber sie ist auch: ein Kind ohne Eltern.
Die Mutter – „ein Engel im Himmel“.
Der Vater – „König auf einer Insel“.
Beide unerreichbar.
Pippi ist allein, und doch wirkt sie unverwundbar. Aber zwischen den Zeilen spürt man: Das ist eine Geschichte gegen die Einsamkeit, eine Geschichte, wo ein Kind stark sein muss.
Pippi kümmert sich um sich selbst. Kocht, putzt, verteidigt sich.
Kinder lieben sie, weil sie tut, was sie wollen.
Erwachsene lieben sie, weil sie etwas lebt, was sie sich nie trauten: radikale Selbstbestimmung.
Aber psychologisch betrachtet, könnte das auch ein Abwehrmechanismus sein. Ein Lebensthema: Ich brauche niemand und beschütze mich selbst, weil niemand anderes da ist.
Vielleicht war Pippi auch ein Wunschbild: für Lasse, ihren Sohn. Damit er lernt, dass Kinder auch ohne Mutter zurechtkommen können. Und für sie selbst. Als Erlaubnis, dass sie sich ihre Schuld verzeihen darf.
Ronja Räubertochter – Der Bruch mit dem Vater
Ronja ist anders als Pippi. Sie lebt mit beiden Eltern im Wald. Ihr Vater Mattis liebt sie abgöttisch. Und doch muss Ronja sich von ihm lösen – als sie sich mit Birk, dem Sohn des verfeindeten Räuberhauptmanns, anfreundet. Sie zieht aus, lebt allein im Wald, stellt sich gegen die Gewalt und das Schwarz-Weiß-Denken ihrer Eltern.
Ronjas Geschichte ist eine Initiationsgeschichte – eine Abnabelung, wie sie viele erleben. Doch sie hat auch eine tiefe, emotionale Note: die Angst, den Vater zu enttäuschen. Die Schuld, seinen Schmerz zu verursachen. Und die gleichzeitige Notwendigkeit, ihren eigenen Weg zu gehen.
Astrid Lindgren selbst hatte ein ambivalentes Verhältnis zu Autoritäten. Ihr Vater war liebevoll, aber sie selbst erlebte oft, wie Normen und Erwartungen Menschen gefügig machen. Ihre Entscheidung, unehelich Mutter zu sein, war ein Bruch mit genau diesen Normen. Wie Ronja – die liebt, aber sich trotzdem abgrenzt.
Mio, mein Mio – Die Sehnsucht nach einem guten Vater
Kaum eine Geschichte ist so traurig und zärtlich zugleich wie „Mio, mein Mio“.
Ein Junge lebt ungeliebt bei Pflegeeltern, bis er in eine andere Welt geholt wird – vom König, seinem wahren Vater. Dort erlebt er Abenteuer, kämpft gegen das Böse und spürt zum ersten Mal: Ich bin gewollt. Ich bin wichtig.
Diese Erzählung ist durchzogen von Wunschfantasien:
Ein Vater, der einen sieht.
Eine Welt, in der man gebraucht wird.
Und ein Kind, das sich selbst als Held erleben darf.
Mio ist Lindgrens einfühlsamste Antwort auf das Lebensthema „nicht dazuzugehören“.
Vielleicht auch eine unbewusste Entschuldigung an ihren Sohn Lasse – den Sie in Pflege gab, weil sie nicht anders konnte. In der Geschichte wird alles gut. Aber nur in der Geschichte.
Die Brüder Löwenherz – Liebe bis über den Tod hinaus
Karl („Krümel“) ist todkrank. Sein großer Bruder Jonathan tröstet ihn: Im Land Nangijala wartet ein neues Leben.
Als Karl stirbt, ist Jonathan schon dort – sie kämpfen gegen Unterdrückung und bleiben zusammen, bis zum Schluss. Am Ende springen sie in ein neues Leben – in das noch jenseitigere Land Nangilima.
Hier das ganze Buch als Hörspiel.
Diese Geschichte erzählt von Tod, Abschied und unzerstörbarer Liebe. Und sie stellt eine Frage, die Lindgren immer wieder bewegte: Was kommt nach dem Schmerz? Gibt es einen Ort, an dem man wirklich sicher ist?
In Interviews sagte sie:
„Ich denke oft an den Tod. Aber nicht aus Angst. Mehr wie jemand, der sich fragt: Und was dann?“
Lindgren verlor später viele enge Freunde und auch ihren Sohn Lasse – lange bevor sie selbst starb. „Brüder Löwenherz“ ist nicht nur eine Kindergeschichte. Es ist ein Abschiedsbuch. Und eine Liebeserklärung an die Hoffnung.
Ein Leben für den Trost
Astrid Lindgren sagte über ihre Motivation zu schreiben:
„Ich wollte ein Zuhause für die Kinder schaffen. Einen Ort, an dem sie verstanden werden.“
Vielleicht suchte sie selbst immer wieder nach diesem Zuhause – einem Ort, an dem sie als Mutter, Frau und Mensch mit ihrer Geschichte nicht verurteilt, sondern verstanden wurde.
Tief beeindruckend ist, wie sie mit ihrer Schuld umging. Sie verdrängte sie nicht. Sie machte sie nicht zum Drama. Aber sie verwandelte sie: in Geschichten, die Halt geben. Sie schrieb sich nicht frei – sie schrieb sich näher an sich heran.
Was hat das mit uns, mit Ihnen zu tun?
Vielleicht viel. Vielleicht erinnern uns ihre Roman-Figuren an unsere eigenen ungelösten Themen:
- Vielleicht spielen auch Sie eine Rolle, die stark wirkt – aber etwas innerlich schützt.
- Vielleicht gab es in Ihrem Leben auch einen Moment, in dem Sie sich trennen mussten – und das nie ganz verdaut haben.
- Vielleicht suchen Sie – wie Mio – nach einem Ort, an dem Sie sicher sind. Gesehen. Gewollt.
Astrid Lindgren lebte uns etwas vor: Nicht, wie man perfekt lebt. Sondern wie man das Unperfekte in etwas Sinnvolles verwandelt.
Mein Fazit:
Astrid Lindgren war mehr als eine Kinderbuchautorin.
Sie war eine Frau mit einem Lebensthema, das sie nicht verleugnete, sondern in etwas Größeres verwandelte. Ihre Geschichten sind keine Flucht – sie sind Verarbeitungsräume. Für sie. Für uns.
Denn manchmal sind es die Leben anderer, in denen wir unser eigenes erkennen.
Neue Perspektiven auf alte Muster – Lebensthemen in Geschichten, Rollen und Biografien
Seit über zehn Jahren beschreibe ich im Persönlichkeits-Blog typische Fallgeschichten aus dem 3-h-Coaching. Immer geht es um verdeckte Konflikte, unbewusste Lebensmuster – und darum, wie man sich ihnen stellt.
Jetzt öffne ich den Blick:
Nicht nur Klient:innen tragen Lebensthemen in sich. Auch Romanfiguren, Künstlerbiografien und prominente Schicksale zeigen uns, was das Leben mit uns macht – und was wir daraus machen.
Diese neue Reihe lädt Sie ein, sich wiederzuerkennen in den Geschichten anderer.
Die Methode bleibt dieselbe:
Schauen, was unter der Oberfläche liegt.
Aufdecken, was unbewusst wirkt.
Erkennen, was es mit uns zu tun hat.
Denn das Leben schreibt keine Fiktion – es verkleidet nur unsere Themen.
Hier lesen Sie Fallberichte aus meiner Coaching-Praxis, wie sich Lebensthemen zeigen können – und was dahinter stecken kann.
Business-Coachings
- „Ich bin Mitte 40 und fühle mich wie in der Pubertät.“
- „Ich habe schlechtes Karma.“
- „Gibt’s das Hochstaplersyndrom auch bei Männern?“
- „Als Schauspieler verhungere ich in meinem Beruf.“
- „Ich kann nicht genießen, was ich habe.“
- „Habe ich mit 35 schon eine Midlife crisis?“
- „Ich ecke überall an.“
- „Die Selbständigkeit machte mir immer Angst.“
- „Warum habe ich so wenig Ehrgeiz?“
- „Meine Redeangst zerstört noch meine Karriere.“
- „Warum hochbegabte Frauen oft tiefstapeln.“
- „Meine Unpünktlichkeit kostet mich noch den Job!“
- „Ich werde immer übersehen.“
- „Mein Berufsziel stand schon vor meiner Geburt fest.“
- „Was mache ich mit den ganzen Idioten in meiner Firma?“
- „Ich sei passiv-aggressiv, meint meine Chefin.“
- „Ich fühle mich nirgends zugehörig.“
- „Warum sabotieren wir uns selbst?“
- „Im Aufschieben bin ich Weltmeister!“
- „Mit 45 bin ich immer noch der Juniorchef.“
- „Ich bin einfach zu nett!“
- „Karriere Top, Privatleben Flop!“
- „Ich kann mich nicht entscheiden.“
Life-Coachings
- „Die Depression killt noch unsere Beziehung“.
- „Ich muss auswandern. In Deutschland ersticke ich.“
- „Darf ich mich nach vierzig Jahre Ehe trennen?“
- „Ich muss überall den Clown spielen.“
- „Warum verliebe ich mich immer in Narzissten?“
- „Warum will ich kein Kind?“
- „Wieviel schuldet man seinen Eltern?“
- „Ich muss immer was zu tun haben.“
- „Ich will mein altes Leben zurück, dachte ich die ganze Zeit.“
- „Am Grab meiner Mutter bin ich täglich.“
- „Von der Kinderverschickung habe ich heute noch Alpträume.“
- „Ich bin immer für alle da aber niemand für mich.“
- „Darf man seine Eltern enttäuschen?“
- „Gibt’s gegen Verbitterung keine Pille?“
- „Vom Rentenalter habe ich immer geträumt.“
- „Leider verdiene ich dreimal so viel wie mein Mann.“
- „Unsere Eltern sind gegen unsere Heirat.“
- „Meine Metapher lautet: Das Leben ist eine Schule.“
- „Meinen Geburtstag feiere ich schon lange nicht mehr.“
- „Stark sein musste ich schon als kleines Mädchen.“
- „Warum kann ich nicht treu sein?“
- „Was bedeutet mein Alptraum?“
- „Ich stecke im falschen Leben fest.“
- „Warum habe ich Krebs?“
- „Ich habe Todesangst. Können Sie mir helfen?“
- „Das Grübeln machte mich ganz depressiv!“
- „Wozu muss ich erwachsen werden?“
- „Ich bin immer in der Opferrolle.“
- „Soll ich ihn wirklich heiraten?“
- „Wenn die Schwiegermutter die Ehe zu zerstören droht, muss Mann handeln.“
- „Ich hasse meine Mutter und soll sie jetzt pflegen?“
PS: Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt.
Haben Sie auch ein persönliches Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten?
Dann buchen Sie auch ein 3-h-Coaching. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Versprochen!
Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, so zu coachen?
Dann lesen Sie hier …
 Welche Erinnerungen haben Sie an die Bücher von Astrid Lindgren?
Welche Erinnerungen haben Sie an die Bücher von Astrid Lindgren?
PS: Wenn Ihnen dieser Beitrag gefiel, dann sagen Sie es doch bitte weiter: auf Facebook, X oder per Email.
… oder schreiben Sie einen Kommentar.
oder abonnieren Sie oben links meine „Sonntagsperlen“.